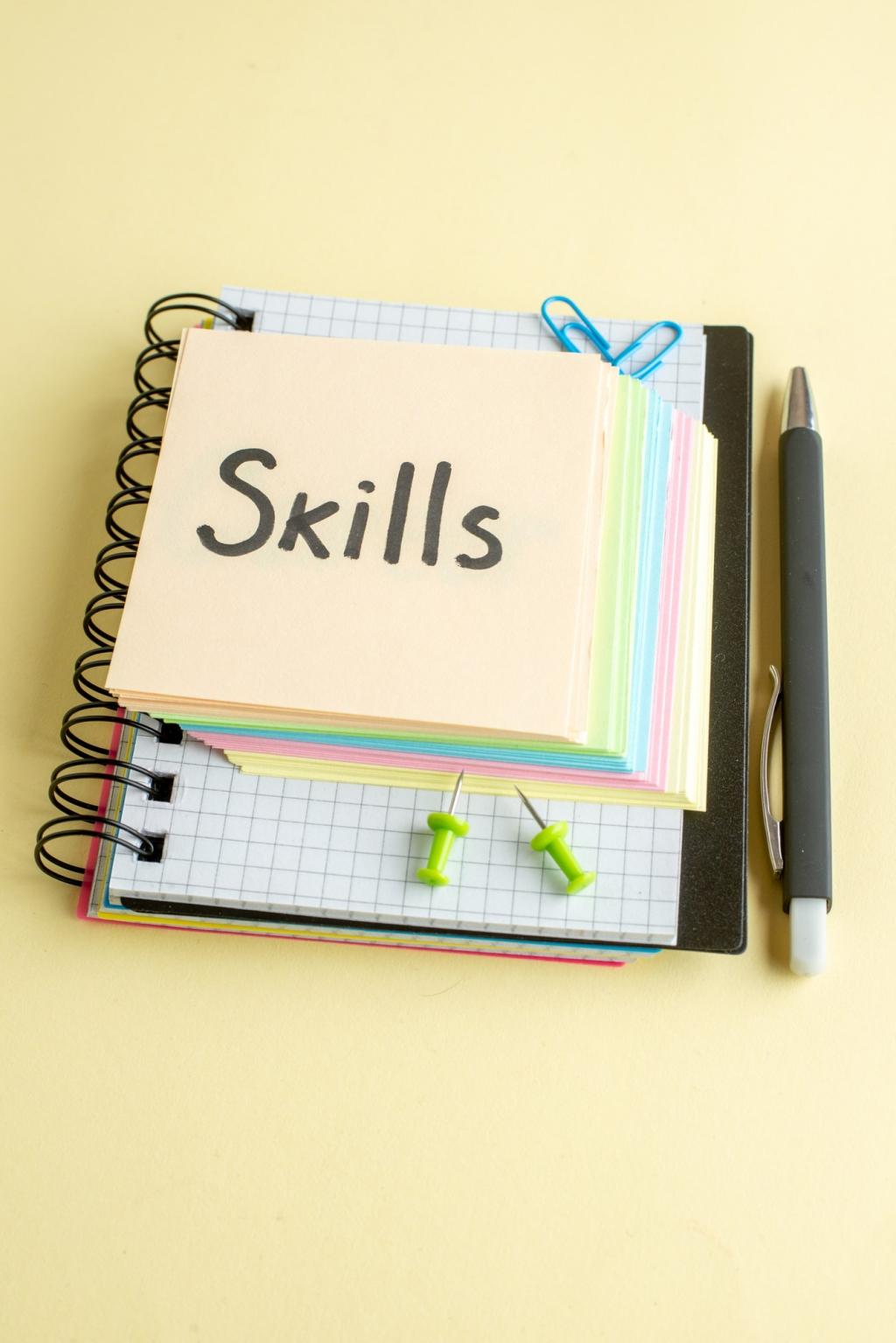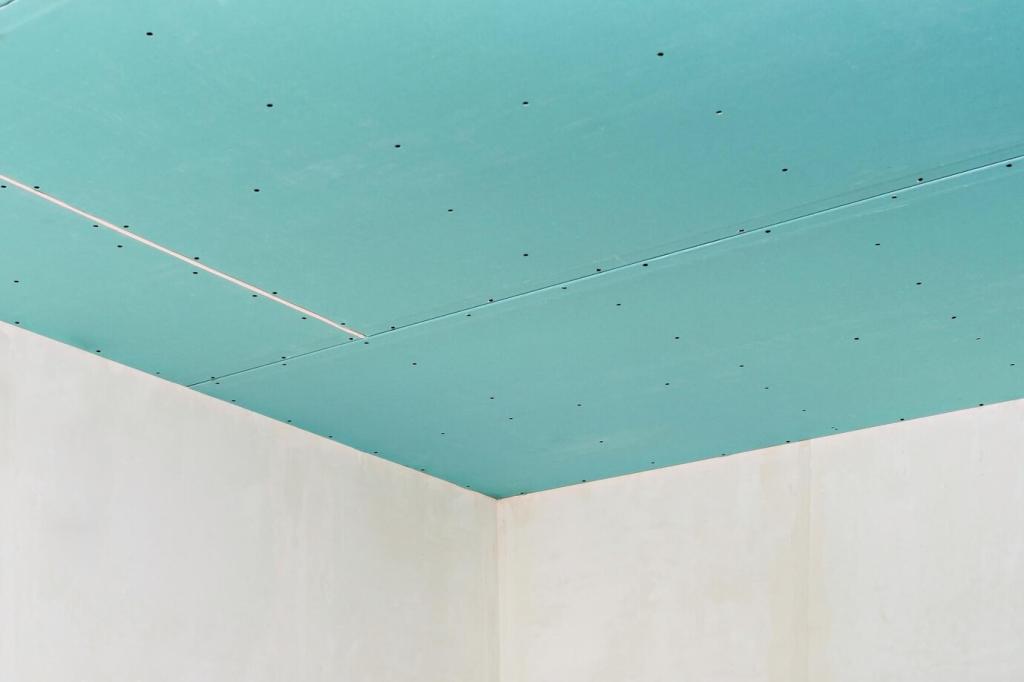Kontinuierliches Lernen: Routinen, die bleiben
Ein wöchentlicher Lernslot von 45 bis 90 Minuten schafft Verbindlichkeit. In dieser Zeit werden Kurse, interne Playbooks oder Experimentieraufgaben bearbeitet. Wer Ergebnisse teilt, inspiriert andere und verhindert, dass Wissen als stiller Besitz weniger Menschen hängen bleibt.
Kontinuierliches Lernen: Routinen, die bleiben
Tandems oder kleine Lerngruppen erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dranzubleiben. Kurze Demos, Showcases und gemeinsame Retros beschleunigen Fortschritt. Mentoring senkt Hürden für Einsteigerinnen und Einsteiger und eröffnet erfahrenen Kolleginnen und Kollegen eine Bühne, ihr Wissen wirksam weiterzugeben.